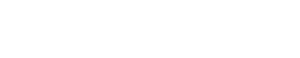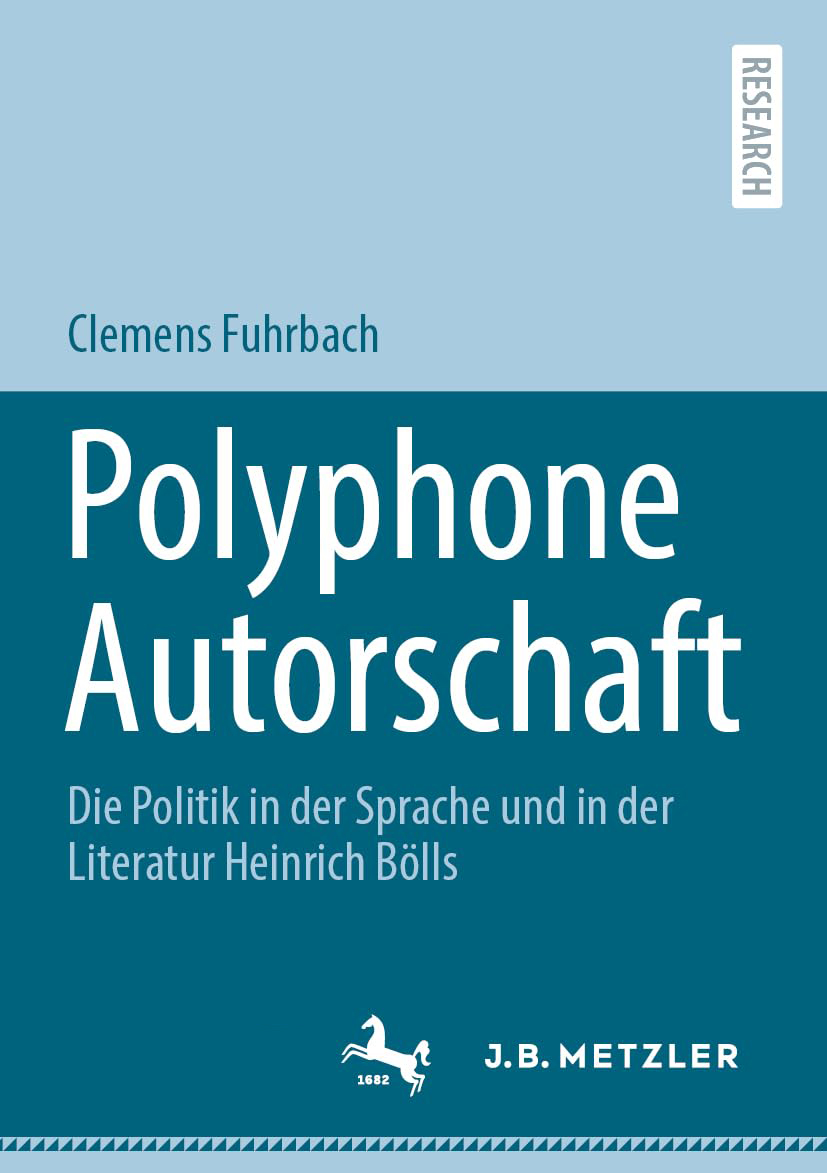Hallo Welt!
Du bist, wer du bist
Du bist der Fighter, drehst deine Runden. Du atmest tief, formst das Ende, scharf wie ein Messer. UND SIE? Die checken nichts, die gucken nur, während du den Takt vorgibst. Sag ihnen: „Nicht mit mir!“
Die Schule sagt dir, du brauchst Wissen, als wär’s der Schlüssel zum Glück. Aber weißt du was? Du gehst deinen eigenen Weg. Dein Wissen, das reicht – der Rest? Der kann warten. Und wenn der Lehrer dir sagt, du musst das wissen, um weiterzukommen, dann sagst Du:
„Wo bleibt der Platz für mich?“
Die haben ihre Schablonen, ihre Regeln. Aber du? Du bist der, der mit den Ecken und Kanten. Der, der durchbricht, der in den Ecken gräbt, wo andere nicht hinkommen. Du bist, wer du bist. Hinter deiner Tür steckt der wahre Schlüssel – und der passt nicht in ihre Welt. Du bist mehr als das, was sie sehen. Die alten Muster? Lass stecken. Dein Wert liegt in dem, was du aus dir machst. Wohin du gehst, bleibt dir überlassen.
Clemens Fuhrbach lebt und arbeitet in Köln. Er ist promovierter Germanist, Lehrer, Musiker und Autor. In seiner Arbeit verbindet er Theorie, Praxis und Kunst – mit einem Fokus auf Literatur, Ethik und digitaler Kultur. Seine Songs und literarischen Texte kreisen um Fragen der Identität, Sprache und gesellschaftlichen Teilhabe. Neben wissenschaftlichen Publikationen entwickelt er künstlerische Projekte.